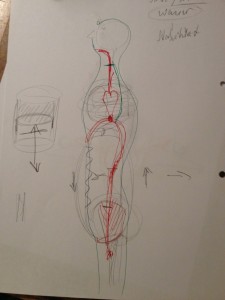wie Helge Schneider sagt, bzw. singt. Mit dem Lernen ist es ja nicht so einfach. Die Institutionen, in denen kognitiv gelernt werden soll, wie Schulen und Universitäten, beschäftigen sich primär mit den Inhalten und der Vermittlung und überlassen den Schülern und Studenten die Art und Weise des Lernens. Es gibt da natürlich etliche rühmliche Ausnahmen.
Dass der Körper bei psychischen Prozessen eine Rolle spielt, braucht an dieser Stelle nicht mehr betont zu werden. Wie stark körperliche Prozesse, ja bloße Körperhaltungen psychische Vorgänge beeinflussen, ist für mich aber immer wieder erstaunlich. Diverse Studien belegen z.B. dass die Haltung des Arms schon ausreicht, signifikante Unterschiede in der Kreativität messen zu können (Green, N. & Raab, M. (2003)), neue Inhalte deutlich unterschiedlich bewertet werden (Cacioppo, Priester und Berntson (1993)) oder sogar die Menge der Nahrungsaufnahme beeinflusst wird (Förster, J. (2003)).
Grundlage dieser Experimente war die unterschiedliche Aktivierung der Armmuskeln. Unterschieden wurde zwischen der Beuge- und der Streckmuskulatur; erstere ist mit Annäherung gekoppelt (wie dann, wenn man einen Gegenstand oder eine Person an sich presst), letztere mit Vermeidung („Zurückstossen“). Die Muskelaktivierung kann nun z.B. dadurch hervorgerufen werden, dass Versuchspersonen mit der Handfläche von oben auf eine Tischfläche pressen (Streckmuskeln aktiviert) oder von unterhalb der Tischplatte nach oben pressen (Beugemuskeln aktiviert), beides Mal im Rahmen einer neutralen Anweisung.
Toll, oder? Mein Körper nimmt an, also lerne ich, mein Körper lehnt ab, also lerne ich nicht oder zumindest ungern. Wie gesagt: Lernen, lernen, popernen!

 Unser Gehirn ist ein erstaunliches Ding und es wird ja überhaupt viel Aufhebens darum gemacht, wie mächtig, wichtig/ unwichtig, nützlich/ hinderlich. etc. es ist. In den Vorträgen von Menschen, die es wahrscheinlich gut nutzen wie z.B.
Unser Gehirn ist ein erstaunliches Ding und es wird ja überhaupt viel Aufhebens darum gemacht, wie mächtig, wichtig/ unwichtig, nützlich/ hinderlich. etc. es ist. In den Vorträgen von Menschen, die es wahrscheinlich gut nutzen wie z.B.